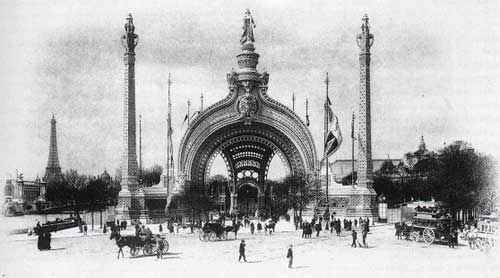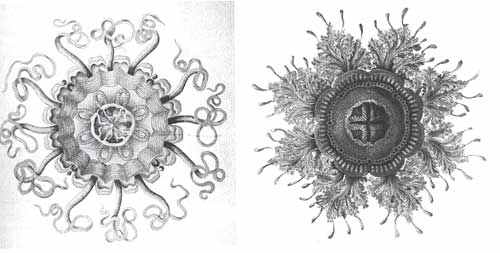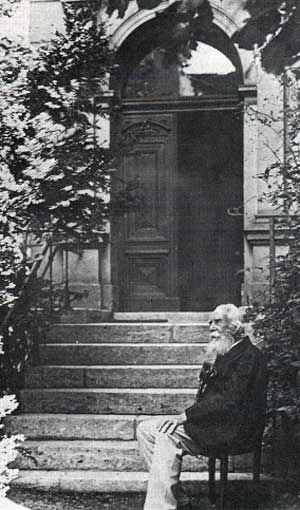Der Lebenslauf von Ernst Haeckel
Entwicklungsjahre und Studentenzeit
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Geboren wurde Ernst Heinrich Philipp August Haeckel am 16.
Februar 1834 als zweiter Sohn des Regierungsrates Carl Gottlob Haeckel
und dessen Ehefrau Charlotte, geborene Sethe, in Potsdam.
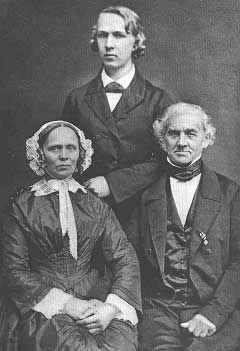
Ernst Haeckel mit seinen Eltern (1857)
Haeckels Jugendzeit fiel in die Periode der
bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848. Er erlebte
Adelsherrschaft, politische Zersplitterung und die nationale Ohnmacht.
Haeckel hasste von Jugend an Junkertum und feudale Kleinstaaterei. Als
reifer Gelehrter stand er unter dem Einfluss der Bismarck-Ära. Als Greis
wurde er mit dem ersten Weltkrieg und dessen verheerenden Folgen
konfrontiert.
Die Erziehung durch den Vater war streng, doch hat er wohl von ihm das
lebhafte, leicht erregbare, leidenschaftliche Temperament geerbt. Er
selbst schrieb es dem Einfluss seines Vaters zu, dass er sich später
nicht in der Erforschung des Einzelnen verlor, sondern sich immer einen
allgemeinen Überblick bewahrte. Von der Mutter, an die er eine
außergewöhnlich starke Bindung hatte, erbte er die große Sensibilität.
So schreibt er einmal:
"Gleich meiner Mutter konnte ich oft in lebhaftes Entzücken über den
Anblick einer bunten Blume, eines niedlichen Vogels, eines farbenreichen
Sonnenuntergangs geraten".
Beide Eltern waren literarisch (hier waren es vor allem die Werke
Goethes) und philosophisch sehr interessiert und gaben diese Neigungen
an ihren Sohn weiter.
Im Jahre 1835 übersiedelte die Familie nach Merseburg. Dort verbrachte
Ernst Haeckel seine Kindheit und Jugend bis zum 18. Lebensjahr. Den
ersten Unterricht erhielt Haeckel von seiner Mutter, unter ihrer
Anleitung sammelte er erste gärtnerische Erfahrungen. Auch eine kleine
Schmetterlingssammlung legte er an. Im sechsten Lebensjahr engagierten
die Eltern den Privatlehrer Karl Gude, der Haeckel sehr früh mit der
systematischen Botanik vertraut machte, etwas , was er im Domgymnasium,
das er bis zum Abitur 1852 besuchte, sehr vermisste. Den Lehrplan hat er
heftig kritisiert:
"Das Hauptgewicht wurde auf die genaue Kenntnis des griechischen und
römischen Altertums gelegt, auf die völlige Beherrschung der
griechischen und lateinischen Sprache (....) Erst in zweiter Linie kam
die deutsche Sprache und Literatur, sodann Französisch und Mathematik.
In dritter Linie, ganz im Hintergrunde, standen Geographie und
Naturkunde".
Aus dieser Erfahrung heraus hat Haeckel sich später immer wieder für
eine Stärkung des naturkundlichen Unterricht in den Schulen eingesetzt.
Doch auch in der Domschule gab es einen Lehrer (Otto Gandtner), der
Mathematik und Naturkunde unterrichtete und der es wagte, in der
traditionsreichen 300 Jahre alten Domschule physikalische und chemische
Experimente durchzuführen. Naturwissenschaftliche Kenntnisse erwarb sich
Haeckel überwiegend in seiner Freizeit, in der er botanisierte und ein
umfassendes Schülerherbarium anlegte. Schon damals zeigte sich sein
Zeichentalent. Weiter las er viel: Klassiker der deutschen Literatur,
Natur- und Reisebeschreibungen und Darwins "Naturgeschichtliche Reisen".
Durch das Buch "Die Pflanze und ihr Leben" von Matthias Jacob
Schleiden, das er als 14jähriger las, wurde er so stark beeindruckt,
dass er beschloss, Botanik zu studieren. Nach bestandenem Abitur - am
12. März 1852 - immatrikulierte sich Ernst Haeckel jedoch auf den
dringenden Wunsch des Vaters hin in Berlin als Student der Medizin und
der Naturwissenschaften. Seine hochgespannten Erwartungen wurden im
Verlauf des ersten Semesters nur teilweise erfüllt, denn ein
eigentliches botanisches Institut für mikroskopische Untersuchungen
existierte in Berlin nicht. Auch von Würzburg, wo er sein Studium unter
Virchow fortsetzte, war er sehr enttäuscht, fühlte sich unglücklich und
meinte für das Medizinstudium total ungeeignet zu sein. In den Briefen
an seine Eltern zeigte sich seine Verzweiflung:
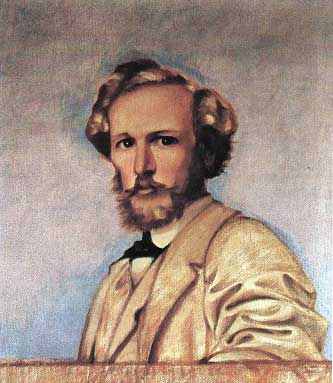
Ernst Haeckel als Student
"Ja, armer Dr. med, ärmster stud. med. Wenn Ihr wüsstet , wie
es mit diesem aussieht. Ich will euch gleich ganz offen sagen,
dass mir der stud. med. noch niemals so leid gewesen ist, wie jetzt. Ich
habe jetzt die feste Überzeugung, ... dass ich nie praktischer Arzt
werden, nicht einmal Medizin studieren kann."
Dabei versicherte Haeckel, dass es nicht der erste Ekel der
Sezierübungen sei, der ihn hinderte, sondern "eine unüberwindliche
Abscheu gegen alles Krankhafte".
Die Eltern, von den Stimmungsschwankungen ihres sensiblen Sohnes nicht
überrascht, aber um seine Zukunft besorgt, ermunterten ihn immer wieder,
das Medizinstudium auf jeden Fall bis zum praktischen Arzt
fortzusetzen, ohne ihn jedoch "unbarmherzig zu zwingen", wie Haeckel
später darstellte. Immer wieder versicherte der Vater ihm, dass er den
Arztberuf später nicht ausüben müsse. Haeckel wusste dabei, dass es nur
über das Studium der Medizin möglich war, sich eingehend mit
vergleichender Anatomie und Entwicklungsgeschichte zu beschäftigen sowie
intensive mikroskopische Untersuchungen und Meereszoologie zu
betreiben. Er war fasziniert von der Formenvielfalt und Schönheit der
niederen Seetiere und arbeitete weit über das geforderte Maß hinaus. So
schrieb er an seine Eltern:
"Erst heute komme ich dazu, Euch wieder einmal zu schreiben, da die
wundervollen Polypen, Quallen, Korallen usw. mich die ganze vorige und
jetzige Woche von früh 5 bis abends 10 beschäftigt und mir das größte
Vergnügen gemacht haben."
Aber auch Virchows mikroskopischen Untersuchungen an krankhaft
veränderten Geweben und Zellen konnte er für sein Arbeitsgebiet etwas
abgewinnen. Die Virchowschen Gedanken zur Zellforschung waren neuartig
und originell und Haeckel berichtet begeistert:
"Ja, über die Zellentheorie geht mir nichts! (...) Für mich ist es das
Anziehendste, was es gibt und dem Studium und der Erforschung der Zelle
möchte ich alle meine Kräfte widmen.... Vivant cellulae!"
Entscheidend für seinen wissenschaftlichen Werdegang wurden für Haeckel
die Vorlesungen des damals berühmten Johannes Peter Müller über
vergleichende Anatomie und Physiologie. Einen weiteren Bildungsimpuls
gaben seine Reisen: eine Tropenreise, ein Kindheitstraum, weiterhin
Reisen an die französische und italienische Mittelmeerküste und nach
Helgoland, die er mit Müller durchführte. Auf Helgoland reifte sein
Entschluss, seine Lebensarbeit der Meeresbiologie zu widmen.
Im Dezember 1854 legte Haeckel in Berlin das "Examen physicum" ab,
Ostern 1855 setzte er sein Studium in den klinischen Fächern in Würzburg
fort. Nicht mehr die praktische Medizin brachte ihn jetzt in Konflikte,
sondern es waren weltanschauliche Probleme. Nicht nur Virchow, sondern
die Mehrzahl der Naturforscher und Ärzte vertraten materialistische
Anschauungen und erschütterten das Fundament seines christlichen
Weltbildes. Haeckel war es unbegreiflich, dass man "mit dieser
Überzeugung leben konnte und dabei ein edler, guter Mensch war." Er
ahnte nicht, dass er wenige Jahre später selbst sich radikal vom
christlichen Glauben abkehren würde.
In Würzburg wurde er unter Virchow "Königlich bayrischer Assistent an
der pathologisch-anatomischen Anstalt zu Würzburg" mit monatlich 12 1/2
Gulden und als Virchow bald darauf nach Berlin gerufen wurde, folgte ihm
Haeckel nicht, sondern entschied sich für die wissenschaftliche
Zoologie. Wieder reiste er an das Meer, dieses Mal nach Nizza, um sich
den Krebstieren zuzuwenden. Er promovierte 1857 über den Flusskrebs.
Sein Staatsexamen legte er im August des gleichen Jahres in Berlin ab.
Im März 1858 wurde er approbiert und eröffnete formell eine Praxis im
väterlichen Haus. Der Erfolg seiner ärztlichen Tätigkeit war gering,
kein Wunder, hatte er die Praxis doch nur von 5-7 Uhr morgens geöffnet.
In seiner freien Zeit wollte er bei Johannes Müller
vergleichend-anatomische und mikroskopische Studien betreiben, doch
starb Müller unerwartet. In dieser schwierigen Situation bot ihm seine
Cousine Anna Sethe Halt. Am 14. September 1858 verlobte er sich in
Heringsdorf mit ihr.

Haeckels erste Frau Anna Sethe
Der Weg zur Zoologieprofessur und Institutsgründung in Jena
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
An der kleinen Universität Jena war die Zoologie in den
ersten Jahrzehnten des 19. Jh. keine selbständige akademische Disziplin.
Erst langsam entwickelte sich über das Zoologische Museum unter
Gegenbaur ein selbständiger Zweig. Bevor Haeckel diesen übernehmen
konnte, musste er sich habilitieren. Zunächst aber trat er - wieder mit
finanzieller Unterstützung des Vaters - eine Reise nach Messina, Rom und
Neapel an. In Florenz kaufte er sich ein leistungsfähiges kleines
Mikroskop, dessen Anschaffung er dem Vater wegen des hohen Preises
zunächst nicht mitzuteilen wagte, das sich aber später bei seinen
Planktonuntersuchungen als außerordentlich wertvoll erwies. Zwar
arbeitete er zunächst angestrengt über Seesterne und unbekannte
Radiolariengruppen, doch wurde er dann so von der Landschaft Italiens
auf der Insel Ischia überwältigt, dass er - unter dem Einfluss des
norddeutschen Dichters Hermann Allmers - ernsthaft überlegte, ob er
Landschaftsmaler werden solle. Doch der Vater zeigte sich dieses Mal
unnachgibig und wollte keinesfalls für diesen Beruf eine Unterstützung
gewähren. Schließlich gelang es Haeckel bis zu seiner Abreise 120 neue
Radiolarienarten sicher zu unterscheiden. Über dieses Thema habilitierte
er sich dann schließlich am 4. März 1861. Und schon am 24. April begann
er im Zoologischen Museum vor neun eingeschriebenen Hörern seine erste
Vorlesung. Noch aber war Haeckel nicht Professor und benötigte weiterhin
die finanzielle Unterstützung des Vaters. Erst mit der Ernennung zum
außerordentlichen Professor im Juni 1862 und dem damit verbundenen
höheren Gehalt war die Voraussetzung für eine Eheschließung gegeben.
Zwei Monate später heiratete Haeckel Anna Sethe in Berlin.
Haeckel war im Sommer 1860 auf Darwins epochemachendes Werk "Entstehung
der Arten" aufmerksam geworden und bekannte sich sofort zu dieser neuen
Theorie. In den folgenden Jahren interpretierte er nicht nur die
Evolutionstheorie, sondern erweiterte sie was den Ursprung des Lebens
und die Herkunft des Menschen anbetrifft. Im Gegensatz zu Darwin wies er
auch sofort auf die weltanschaulichen Konsequenzen hin. Der damals
29-jährige setzte mit dem offenen Bekenntnis zu Darwin seine eben erst
begonnene Laufbahn aufs Spiel.  Am Tage seines 30. Geburtstages wurde er
für seine Radiolarienwerke ausgezeichnet und just am selben Tag starb
nach kurzem Krankenlager seine über alles geliebte Frau Anna. Haeckel
war nicht fähig, an der Beisetzung teilzunehmen, der Vater reiste aus
Berlin an, um ihm zur Seite zu stehen. Ausweg und Halt fand Haeckel nun in der wissenschaftlichen Arbeit.
Belohnt wurde er mit einer ordentlichen Professur in Jena 1865. Der erste Schritt zur Gründung
eines Zoologischen Institutes in Jena war getan, auch wenn die
Ausstattung in jeder Hinsicht primitiv war. In einer Eingabe an das
Weimarische Staatsministerium forderte Haeckel Mittel für die
Einrichtung, denn "mit einer Porzellanschüssel, einem Napf, einer alten
Pinzette und einigen alten Scheren" ließe sich schwerlich arbeiten. Er
erhielt 300 Reichstaler zur instrumentalen Ausstattung und 1869 eine
geräumige Dienstwohnung. Parallel zu dieser enormen Verbesserung
entwickelte sich auch die Zahl der Studenten. Schließlich erreichte
Haeckel 1882 den Neubau eines modernen und großzügig angelegten
Zoologischen Instituts im Garten des ehemaligen Döbereinerschen Hauses.
Am Ende seines Lebens hat Haeckel immer wieder betont, dass ihm keine
andere als die vom Geist der Goethe-Zeit geprägte Jenaer Universität so
günstige Schaffensmöglichkeiten hätte bieten können. 1883 konnte er auch
in sein Wohnhaus, die "Villa Medusa", einziehen, die er in
unmittelbarer Nähe des Instituts im Stile eines oberitalienischen
Landhauses hatte bauen lassen. Am Tage seines 30. Geburtstages wurde er
für seine Radiolarienwerke ausgezeichnet und just am selben Tag starb
nach kurzem Krankenlager seine über alles geliebte Frau Anna. Haeckel
war nicht fähig, an der Beisetzung teilzunehmen, der Vater reiste aus
Berlin an, um ihm zur Seite zu stehen. Ausweg und Halt fand Haeckel nun in der wissenschaftlichen Arbeit.
Belohnt wurde er mit einer ordentlichen Professur in Jena 1865. Der erste Schritt zur Gründung
eines Zoologischen Institutes in Jena war getan, auch wenn die
Ausstattung in jeder Hinsicht primitiv war. In einer Eingabe an das
Weimarische Staatsministerium forderte Haeckel Mittel für die
Einrichtung, denn "mit einer Porzellanschüssel, einem Napf, einer alten
Pinzette und einigen alten Scheren" ließe sich schwerlich arbeiten. Er
erhielt 300 Reichstaler zur instrumentalen Ausstattung und 1869 eine
geräumige Dienstwohnung. Parallel zu dieser enormen Verbesserung
entwickelte sich auch die Zahl der Studenten. Schließlich erreichte
Haeckel 1882 den Neubau eines modernen und großzügig angelegten
Zoologischen Instituts im Garten des ehemaligen Döbereinerschen Hauses.
Am Ende seines Lebens hat Haeckel immer wieder betont, dass ihm keine
andere als die vom Geist der Goethe-Zeit geprägte Jenaer Universität so
günstige Schaffensmöglichkeiten hätte bieten können. 1883 konnte er auch
in sein Wohnhaus, die "Villa Medusa", einziehen, die er in
unmittelbarer Nähe des Instituts im Stile eines oberitalienischen
Landhauses hatte bauen lassen.
Wissenschaft, Darwinismus und Weltanschauung
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die Jahre 1865/66 gehören zu den erfolgreichsten und
wissenschaftlich fruchtbarsten in Haeckels Leben. Im Wintersemester
1865/66 las er erfolgreich über Darwin: Haeckel musste den größten
verfügbaren Hörsaal benutzen. Neben 120 eingeschriebenen Hörern nahmen
Laien aller Berufsstände teil.
Ausgehend von der Forderung nach einer streng mechanistisch-kausalen
Naturbetrachtung begründete Haeckel in seinem Werk der "Generellen
Morphologie" ein philosophisches System des Monismus. Darin lehnte er
jede dualistische Weltanschauung ab und postulierte die Entstehung der
ersten Organismen aus anorganischer Materie. In die Zeit 1872 fällt die
Formulierung des Biogenetischen Grundgesetzes, wonach die
Individualentwicklung eine kurze Rekapitulation der Stammesentwicklung
darstellt. Schon zu Lebzeiten erntete er für seine Thesen Kritik;
besonders polemisch waren die Auseinandersetzungen über die Entwicklung
des Menschen aus affenähnlichen Vorstufen. Haeckel antwortete:
"Interessant und lehrreich ist dabei nur der Umstand, dass besonders
diejenigen Menschen über die Entdeckung der natürlichen Entwicklung des
Menschengeschlechts aus echten Affen am meisten empört sind und in den
heftigsten Zorn geraten, welche offenbar hinsichtlich ihrer
intellektuellen Ausbildung und cerebralen Differenzierung sich bisher
noch am wenigsten von den gemeinsamen tertiären Stammeltern entfernt
haben."
1867 ging Haeckel eine zweite Ehe mit Agnes Huschke, der jüngsten Tochter des Jenaer Anatom Emil Huschke, ein.

Ernst Haeckel mit seiner zweiten Frau Agnes Huschke und den Kindern Walter und Elisabeth (1874)
In den ersten Ehejahren folgte ihm Agnes mit Begeisterung in
allen Situationen, später erwies sich die Verbindung als problematisch.
Agnes litt unter den oft monatelangen Trennungen während Haeckels
zahlreicher Reisen ebenso wie unter den zunehmend wissenschaftlichen und
weltanschaulichen Kämpfen, in die ihr Mann verstrickt war. Vor allem
die Anwendung der Evolutionstheorie auf die Stammesgeschichte des
Menschen stieß nicht nur in kirchlichen Kreisen auf erheblichen
Widerstand. Im Mittelalter hätte ihn sein Buch "Anthropogenie"
vermutlich vor die Inquisition gebracht. Mit dem hochverehrten Lehrer
Rudolf Virchow entspann sich eine Kontroverse, die in erbitterter
Gegnerschaft endete. Vor allem als Haeckel öffentlich forderte, dass die
Evolutionstheorie in den Schulen gelehrt werden müsse, unterstellte
Virchow ihr staatsgefährdende Tendenzen und boykottierte somit ein neues
Unterrichtsgesetz. Überzeugt von der Wahrheit seiner Ansichten kämpfte
Haeckel mit allen Mitteln für die Anerkennung und Popularisierung der
Evolutionstheorie. Sein vielzitierter Kampfruf war: "Impavidi
progrediamur" (Unerschrocken lasst uns vorwärts schreiten).
Vortragsreisen durch 13 Städte bis Triest riefen zwar die Zustimmung
breiter Bevölkerungsschichten hervor, jedoch auch den erbitterten
Widerstand der Kirche. Darwins und Haeckels Schriften wurden in höheren
Schulen verboten, 1882 wurde dann in Preußen der biologische Unterricht
in der Oberstufe der Gymnasien abgeschafft.
Während der aufreibenden Kämpfe um den Entwicklungsgedanken ließ Haeckel
aber seine wissenschaftlichen Arbeiten nicht ruhen. 1872 - 1876 wurde
auf der sog. Challenger-Expedition (von der Royal Society durchgeführt)
an 354 verschiedenen Stellen in den Weltmeeren die Tiefseefauna
untersucht. Haeckels Auswertung des Challenger-Materials dauerte zwölf
Jahre und beanspruchte ihn stark. In dieser Zeit unternahm er noch 16
ausgedehnte Reisen, u.a. in die Tropen und in den Vorderen Orient. Seine
Eindrücke und Erlebnisse gab er in den "Indischen Reisebriefen" wieder
oder stellte sie künstlerisch dar, so etwa in 50 Aquarellen von der
Orientreise. Mit dem Abschluss der Challenger-Monographien widmete sich
Haeckel verstärkt der Popularisierung des Evolutionsgedankens und dem
Ausbau des Monismus. 1892 opponierte Haeckel in einer Reihe von
Aufsätzen gegen das reaktionäre Volksschulgesetz. Er forderte einen
stärker naturwissenschaftlich orientierten Unterricht und eine
Bevorzugung der neueren Sprachen gegenüber den klassischen, weiterhin
angemessenen Kunstunterricht und mehr sportliche Betätigung. In seinem
berühmten Buch "Die Welträtsel (1899)" versuchte er seine monistische
Philosophie zu veranschaulichen. Das Buch wurde Haeckels größter Erfolg.
Es wurde in über 400000 Exemplaren aufgelegt und in mehr als 30
Sprachen übersetzt. ( 1903 erschien noch eine billige Volksausgabe) Der
antiklerikale Charakter des Buches rief einen Sturm der Entrüstung
hervor, zumal Haeckel immer wieder die Trennung von Staat und Kirche
forderte. Ein Abgeordneter des preußischen Herrenhauses warnte
eindringlich vor dem "unheilvollen Einfluss, welchen die ‚Welträtsel'
besonders auf Primaner, Volksschullehrer und höhere Töchter ausübe". Als
Antwort darauf begann Haeckel eine Vortragsreihe.
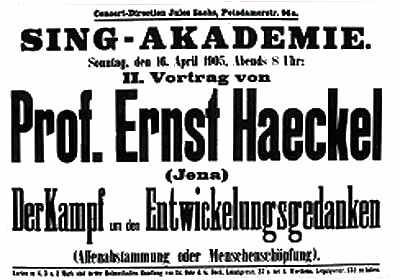
Die kirchlichen Kreise antworteten mit aller Schärfe und
Haeckel bemerkte dazu: "Die Flut von Beschimpfungen und Verleumdungen
aller Art, welche die 'frommen Blätter'- voran der lutherische
Reichsbote und die römische Germania- über mich ergossen, überstieg
alles bisher dagewesene."
Um die gesellschaftliche Reaktion zu begreifen, müssen wir uns näher mit
dem Forschungsgebiet Haeckels befassen. Was können wir nun zunächst
über den Naturwissenschaftler Haeckel sagen?
Der Naturwissenschaftler Haeckel
Die Selektionstheorie
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Im Sommer 1860, als Haeckel an seiner Radiolarienmonografie
arbeitete, wurde er auf das Werk von Charles Darwin (1809-1882) "Über
die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl" aufmerksam. Sofort
bekannte er sich zu dieser neuen Theorie, die das Weltbild des Menschen
völlig umwälzte. Darwins Theorie entthronte den Menschen als Krone der
Schöpfung. Sein fester Glaube an die Unveränderlichkeit der Arten war
nach einer fünfjährigen Weltreise erschüttert worden und er schrieb
1844:
"Endlich kamen Lichtstrahlen, und ich bin beinahe überzeugt, dass die
Spezies nicht unveränderlich sind. Mir ist, als gestände ich einen Mord
ein. Der Himmel bewahre mich vor Lamarckschem Unsinn einer 'Neigung zum
Fortschritt', der Anpassung in Folge des langsam wirkenden Willens der
Tiere.." (Darwin: Die Entstehung der Arten).
Dabei war es das Verdienst des französischen Biologen Jean Baptiste
Lamarck (1744 -1829), den Entwicklungsgedanken, der seit dem 18.
Jahrhundert zunehmend an Bedeutung gewann, auszuformuliert zu haben. Das
erste Gesetz Lamarcks lautet: "Organe ändern sich durch den Gebrauch
bzw. Nichtgebrauch". Im zweiten Gesetz folgerte Lamarck, dass diese
Eigenschaften vererbbar seien. Ferner nahm Lamarck als Ursache der
Höherentwicklung einen Vervollkommnungstrieb an.
Wie steht nun Haeckel zu Lamarck? Haeckel hob immer wieder neben Lorenz
Oken und Wolfgang Goethe Lamarck als Vorläufer Darwins hervor. Er hielt
auch die Vererbung erworbener Eigenschaften für weitaus bedeutungsvoller
als Darwin und entwickelte dazu eine eigene fragwürdige Theorie. Sein
ultimatives Vorgehen, sein Desinteresse an den Veröffentlichungen
Gregor Mendels, haben nicht dazu beigetragen, die wichtige Grundfrage
der Entwicklung und Vererbung sachlich zu klären. Eigene
Vererbungsexperimente, wie sie z. B. Darwin an Tauben und Mendel an
Erbsen durchgeführt haben, unternahm Haeckel nicht.
Wie lautet nun die Darwinsche Selektionstheorie?
Darwin ging von folgenden Tatsachen aus:
1. Alle Arten sind veränderlich. Es spielen jedoch nur die vererbbaren Variationen eine Rolle.
2. Alle Arten erzeugen weitaus mehr Nachkommen als schließlich überleben oder sich fortpflanzen.
Darwin folgert daraus:
Es findet eine natürliche Auslese, die Selektion, statt. Dieser "Kampf
ums Dasein" äußert sich so, dass diejenigen Nachkommen, die etwas besser
angepasst sind als ihre Artgenossen, nicht nur die größten
Überlebenschancen, sondern auch die größten Fortpflanzungschancen haben.
Dadurch werden die günstigeren Merkmale - sofern sie eine erbliche Basis
haben - über ihre Träger bevorzugt an die nächste Generation
weitergegeben. So findet eine schrittweise Änderung in jeder Generation
statt.
Jede der aufeinander folgenden Veränderungen ist gegenüber ihrem
Vorgänger einfach. Betrachtet man aber das komplexe Endprodukt und
vergleicht es mit dem ursprünglichen Produkt, so wird die schöpferische
Seite der Selektion deutlich. Sie ist nämlich keine rein negative Kraft,
die nur Schwächliche ausrottet, sondern wirkt dynamisch in dem Sinne,
dass immer besser angepasste Individuen, schließlich neue Arten
entstehen. Und dies war das Revolutionäre, denn dass neue Rassen
innerhalb einer Art entstehen können, war aus der Züchtung hinlänglich
bekannt.
War Haeckel nun lediglich ein deutscher Darwin?
Er war Darwin freundschaftlich verbunden, wechselte Briefe mit ihm und
besuchte ihn mehrmals in England. Darwin, Zeit seines Lebens mit
äußerster Disziplin gegen Krankheiten ankämpfend, äußerte sich einmal
bewundernd gegenüber Haeckel:
"Ich glaube, dass Sie an einem Tag so viel arbeiten wie ich in einer
Woche." Des öfteren ermahnte er ihn aber auch zu mehr öffentlicher
Zurückhaltung.
Haeckel hat Darwins Theorie nicht nur entschieden verteidigt, sondern auch weiterentwickelt.
Abstammungs- und Verwandtschaftsverhältnisse wurden lange Zeit
ausschließlich aufgrund fossiler Funde rekonstruiert. Haeckel befasste
sich nun intensiv mit einer Methode, mit der er meinte, nicht mehr
vollständig auf das lückenhafte paläontologische Material angewiesen zu
sein. Er wandte die von ihm aufgestellte Biogenetische Regel an.
Die Biogenetische Regel oder "Durchlaufen wir in unserer Embryonalentwicklung ein Fischstadium?
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Bereits 1842 hatte Darwin in einem Entwurf und in seinem Werk
"Entstehung der Arten" den Zusammenhang zwischen Individualentwicklung
und Stammesentwicklung dargestellt. Er hat die Bedeutung der
embryologischen Forschungen für die Erkenntnis der Evolution der
ausgestorbenen Vorfahren rezenter Tiere hoch eingeschätzt, betonte aber
auch, dass Unähnlichkeit in der Embryonalentwicklung noch keinen Beweis
für eine verschiedene Abstammung liefert. Ausführliche vergleichende
Untersuchungen der Embryonalstadien verschiedener Wirbeltiere
(einschließlich des Menschen) sind aber das Verdienst Haeckels und
führten zur Formulierung der Haeckelschen oder 'Biogenetischen
Grundregel': "Die Ontogenese ( = Individual-Entwicklung) ist die
kurze und schnelle Wiederholung der Phylogenese ( = Stammesentwicklung)".
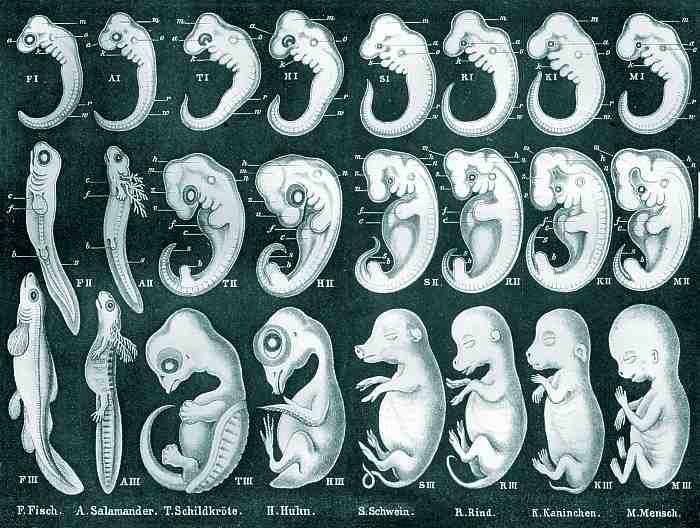
Säugetierembryonen
Es werden also während der kurzen und schnellen
Keimesentwicklung wichtige Stadien wiederholt, die die Ahnenformen im
Laufe der langandauernden Stammesentwicklung durchlaufen haben. Wie
schon Darwin wies Haeckel auf mögliche Störungen in der Ontogenese und
auf Neuentwicklungen hin. Auch die Embryonalstadien unterliegen der
Evolution, doch ist diese Veränderung weitaus weniger spektakulär. Man
muss zur Kenntnis nehmen, dass während der Ontogenese nicht Ahnenformen,
sondern ursprüngliche Organisationsformen, nicht fertige Organe,
sondern deren Anlagen wiederholt werden. So konnte die moderne Genetik
zeigen, dass die Steuerung der Embryonalentwicklung durch die in der
befruchteten Eizelle vollständig enthaltenen Informationen erfolgt. Auch
haben Forscher des Instituts für Genetik in Köln vor wenigen Jahren die
aufregende Tatsache vorgestellt, dass so höchst unterschiedliche
Lebewesen wie eine Fliege, ein Frosch, eine Maus und ein Mensch bei
ihrer Embryonalentwicklung verblüffend ähnliche Steuerungsmechanismen
aufweisen. So hat Haeckels Rekapitulationsthese, obwohl mit
Beobachtungsdaten unbeweisbar, zahlreiche Entdeckungen und Erkenntnisse
in der Embryonalentwicklung provoziert und nimmt nicht nur
wissenschaftshistorisch einen wichtigen Stellenwert in der
Evolutionsforschung ein.
Leben aus toter Materie?
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Haeckel hat es gewagt, auch das Problem vom Ursprung des
Lebens anzugehen. In gewisser Weise hat er heutige Erkenntnisse
vorweggenommen und Darwins Theorie in entscheidender Weise erweitert.
Haeckel bezeichnete als den größten Mangel an Darwins Theorie, dass
jener für die Entstehung des ersten Organismus einen Schöpfungsakt
annimmt. Er schreibt dazu: "Die moderne Entwicklungslehre hat uns aber
überzeugt, dass eine solche 'Schöpfung' niemals stattgefunden hat, dass
das Universum seit Ewigkeit besteht und dass das Substanzgesetz alles
beherrscht.... Die Vorstellung, dass der 'persönliche Gott' als
denkendes immaterielles Wesen die Welt auf einmal aus nichts erschaffen
hat, ist durchaus unvernünftig und im Grunde nichtssagend." (Aus:
Haeckel: Die Lebenswunder, Nachdruck Jena 1904, S. 47).
Haeckel erklärt, dass das Leben von selbst aus anorganischer Substanz,
aus toter Materie entstanden sei. So wie anorganische Kristalle sich in
der Salzlösung bilden und wachsen, sollen in einem Prozess der
sogenannten 'Selbstzeugung' (Autogenie) einfache Eiweißklümpchen
entstanden sein, denen er Lebensqualitäten zuschrieb, wenn sie sich
ernähren, also Stoffwechsel betreiben, wachsen und dann schließlich in
Teilstücke zerfallen ( = Fortpflanzung). Aus solchen Urgebilden, die er
'Moneren' (monos, griech. = einzeln) nannte, sollten sich dann im Laufe
von Jahrtausenden mehrzellige Organismen und schließlich das gesamte
Organismenreich entwickelt haben. Die Hypothese Haeckels der Autogenie
konnte bis heute experimentell nicht bewiesen werden, die Entstehung
eines 'Protobionten' aus anorganischer Materie ist noch nicht gelungen.
Dennoch konnte Haeckel in einigen wesentlichen Punkten bestätigt werden.
1932 hat MILLER in seinem berühmten Versuch in einem Glaskolben die
Bedingungen der Atmosphäre auf der Früherde nachvollzogen, indem er
Gasmischungen aus Methan, Ammoniak, Wasserdampf und Wasserstoff
elektrischen Entladungen aussetzte. Die Ergebnisse dieser Experimente
waren aufregend. Organische Moleküle, wie man sie nur in lebenden
Systemen findet, setzten sich in diesem Kolben spontan zusammen. So
konnte man organische Säuren und Harnstoff, aber auch mehrere
'biotische' Aminosäuren (Bausteine der Eiweißstoffe) nachweisen. Die bei
diesen Reaktionen wirksamen chemischen Kräfte ergeben nicht etwa ein
"Chaos" aller möglichen Verbindungen, sondern es entstehen bevorzugt
ganz bestimmte Stoffe, die nur in lebenden Systemen vorkommen. Bereits
vor 20 Jahren sind Experimente gelungen, bei denen Bakteriengeißeln,
hochorganisierte Strukturen, ja sogar Viren, sich aus ihren
"Teilmolekülen" selbst zusammenbauen. "Selfassembly" erster lebender
Urzellen erscheint zunehmend als Möglichkeit. Sind aber erst einmal
Informationsträger (Erbsubstanz) und Funktionsträger (Eiweiße, die als
Biokatalysatoren wirken) zusammengetreten, ist nach EIGEN ein so
genannter 'Hypercyclus' entstanden, der ungeheuer lebendig ist und sich
in einem 'Selbstbeschleunigungsprozess' schnell vermehrt.
Die Herkunft des Menschen
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
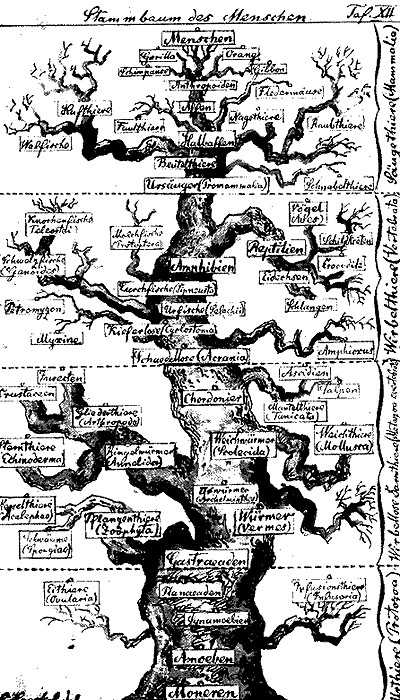
DARWIN hat in seinem Werk "Über die Entstehung der Arten" zur
Evolution des Menschen sehr vorsichtig bemerkt: "Licht wird auf den
Ursprung des Menschen und seine Geschichte fallen" . Haeckel ging hier
weiter. Mutig behandelte er in seinen Vorlesungen die Abstammung des
Menschen von affenähnlichen Ahnen. So schreibt er: "Unsere monistische
Anthropologie ist zu der klaren Erkenntnis gelangt, dass der Mensch nur
ein winziges Teilchen dieses universalen Ganzen ist, ein plazentales
Säugetier, das erst in späterer Tertiärzeit sich aus einem Zweige der
Primatenordnung entwickelt hat" (Aus: Haeckel: Die Lebenswunder,
Nachdruck Jena 1904, S. 291).
Nun gab auch Darwin seine anfängliche Zurückhaltung auf und
veröffentlichte 1871 seine Schrift "Die Abstammung des Menschen und die
geschlechtliche Zuchtwahl". 1874 folgte Haeckels umfassende Ergänzung zu
diesem Problem: "Die Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des
Menschen." Der "Systematische Stammbaum des Menschen" demonstriert
deutlich Haeckels Auffassungen über die Ahnenstufen des Menschen.
An der Wurzel einer alten knorrigen Eiche vermitteln die strukturlosen
Moneren den Übergang zwischen anorganischen und organischen
Naturkörpern. Die weiteren Übergangsformen der menschlichen Entwicklung
erschloss Haeckel nach dem "Biogenetischen Grundgesetz". Dabei hob
Haeckel immer wieder hervor, dass der Mensch nicht von heute noch
lebenden Menschenaffen, sondern von längst ausgestorbenen Formen, wie
Dryopithecus fontani oder Pliopithecus abzuleiten sei. Als
hypothetisches Zwischenglied hatte er die Gattung Pithecanthropus
angenommen.
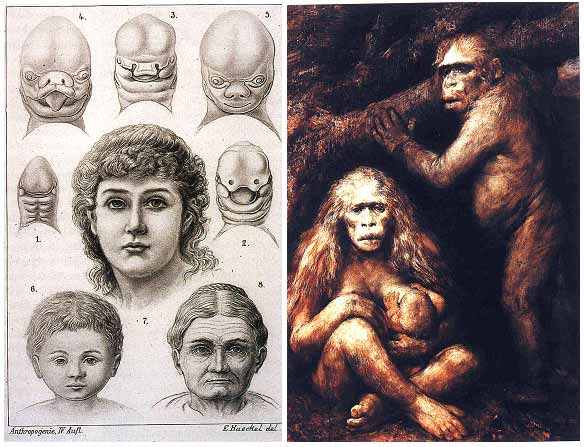
Entwicklung des Gesichts und Pithecanthrophus alatus (Ölgemälde von Prof. Max, Geschenk an Haeckel zum 60. Geburtstag)
Der holländische Arzt Eugen Dubois fand 1891 in Mitteljava
ein Schädeldach und einen Oberschenkel einer menschenähnlichen
Übergangsform, die er als das von Haeckel postulierte Zwischenglied
ansah. Wie wir heute wissen, gehören die Pithecanthropinen der Homo
erectus Gruppe an. Auch Haeckels Vorstellung von Asien als Wiege der
Menschheit wurde schon sehr früh falsifiziert. Nichtsdestotrotz hat
Haeckel die Darwinsche Evolutionstheorie folgerichtig auf die
Abstammungsgeschichte des Menschen übertragen. Und die Entschlüsselung
des genetischen Code hat gezeigt, dass alle Lebewesen, so verschieden
sie auch zu sein scheinen, auf ihrer molekularen Grundlage erstaunlich
einheitlich sind.
Der Philosoph Haeckel
Der Monismus
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Bereits in der Generellen Morphologie der Organismen
formulierte Haeckel als philosophische Grundlage seiner Auffassungen im
Anschluss an August Schleicher und unter Berufung auf Goethe seinen
schon erwähnten MONISMUS, eine naturwissenschaftlich- materialistische
Philosophie, wonach keine Materie ohne Geist und kein Geist ohne Materie
existiere, sondern "EINS BEIDES zugleich sei" und Gott identisch mit
dem allgemeinen Kausalgesetz der Natur selbst sei. Die traditionelle
Schulphilosophie dieser Zeit entwickelte ihre Theorien zum Teil bewusst
in Antithese zur Wissenschaft, wodurch Haeckel und andere an einer
naturwissenschaftlichen Begründung der Philosophie interessiert waren.
Haeckel sah als oberstes allumfassendes Naturgesetz das Substanzgesetz
als untrennbare Einheit des Gesetzes von der Erhaltung des Stoffes
(Lavoisier 1789) und des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft (Robert
Meyer 1842) an. Unter Rückgriff auf den Substanzbegriff Spinozas ordnete
er dieser Universalsubstanz zwei Attribute zu: Materie als
raumerfüllenden Stoff und Energie als bewegende Kraft, später als dritte
Eigenschaft noch das Psychom (Empfindung). Diese Universalsubstanz
verkörpert seiner Auffassung nach gleichzeitig die Vereinigung der
"GOTT-NATUR".
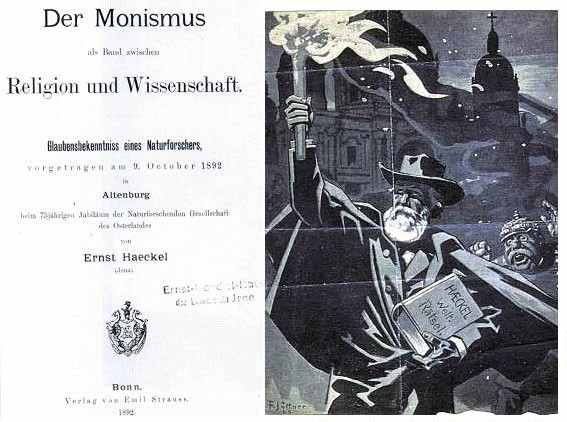
Titelblatt 1892 und Ernst Haeckel als Aufklärer (Lustige Blätter 1900)
Was unterscheidet aber nun den HAECKELSCHEN MONISMUS und
einen MATERIALISMUS?
Haeckel differenziert nicht zwischen belebter und unbelebter Sphäre der
Natur, sondern nach Haeckel ist alles Materielle belebt. Das Materielle
hat selbst eine geistig psychische Dimension. Seele ist dabei eine
Eigenheit des Materiellen, eine zusätzlich im eigentlichen Materialismus
nicht beachtete Dimension der Materie. Insofern formiert sich in seinem
Bild der Welt dann auch faktisch ein Dualismus, in dem den Substanzen
immer noch zu ihrer Materialität eine Beseeltheit zukommt. Da diese aber
notwendige Eigenheit der Materie sei, sei die Konsequenz eben kein
Dualismus, sondern Monismus. Dass all dies auf Einzellerbasis möglich
sei, führt zu Begriffen wie "Zellgedächtnis" (Mneme), zu
"Kristallseelen". Sein Materialismus ist einer der durchgeistigten
Materie und eines Geistes, den es nur auf materieller Grundlage geben
kann, seine Philosophie entzaubert nicht die Welt des Wunderbaren, GOTT
ist identisch mit dem allgemeinen Naturgesetz und der Natur selbst.
Haeckel ist auch in seinen philosophischen Anschauungen ein Kind seiner
Zeit, denn die grundlegenden Entdeckungen und gewaltigen Fortschritte
der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert führten zu einer weitgehend
natürlichen und kausalen Erklärung der Lebensprozesse. Erwähnt seien
hier die Entdeckung der elektro-magnetischen Induktion durch Faraday
1831, der Energieerhaltungssatz von Joule und Helmholtz, das
Periodensystem der Elemente, die Ionenlehre von Svante Arrhenius (1886),
die Entdeckung der Röntgenstrahlen (1895) und der Radioaktivität,
schließlich die Quantentheorie von Max Planck (1900) bis hin zur
Relativitätstheorie. Zusammen mit den schon dargelegten Umwälzungen im
Bereich der Biologie ergab sich auch in weltanschaulicher Hinsicht eine
Revolution, eine Kampfansage an idealistische und insbesondere religiöse
Auffassungen. So wurde 1881 der "Deutsche Freidenkerbund" gegründet,
1892 als Reaktion auf den Schulgesetzentwurf von Zedlitz-Trütschler, der
die gesamte Volksbildung unter kirchlichen Einfluss stellen sollte, die
"Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur". Großen Aufschwung nahmen
auch die Freireligiösen Gemeinden. In diesem Spannungsfeld freigeistiger
Reformbestrebungen ist auch die Gründung des "Deutschen
Monistenbundes" (1906) zu sehen. Haeckel hatte bereits 1904 auf dem
Internationalen Freidenker-Kongress in Rom versucht, eine internationale
Institutionalisierung seiner monistischen Weltanschauung zu erreichen.
Er hatte 30 Thesen zur Organisation des Monismus formuliert, wobei 20
sich auf den theoretischen und 10 auf den praktischen Monismus beziehen.
Unter theoretischem Monismus verstand er eine "reine Weltanschauung auf
Grund der Erfahrung, der reinen Vernunft und der Wissenschaft". Diese
basiert auf der Evolutionstheorie und geht von der Einheit der Natur und
des Kosmos aus und lehnt jede göttliche Offenbarung ab. Er postuliert
die Entstehung des Lebens aus anorganischem Material und bezieht den
Menschen als Nachfahren affenähnlicher Vorfahren in die Evolution ein.
Als praktischen Monismus betrachtete er eine vernünftige Lebensführung
auf der Basis des theoretischen Monismus. Wahrheit, Tugend und
Schönheit, eine aus den sozialen Instinkten der höheren Tiere abgeleitet
Ethik, Trennung von Staat und Kirche, Trennung von Schule und Kirche,
Ersetzen des Religionsunterrichts durch vergleichende
Religionsgeschichte, monistische Erziehung durch Training von Körper und
Geist. Nach jahrelangen Bemühungen, eine zentrale Organisation zu
gründen, fand endlich am 11. Januar 1906 in Jena die
Gründungsversammlung statt. Ein Jahr später hatte der Monistenbund ca.
2500 Mitglieder. Als Gegenorganisation wurde der evangelische Keplerbund
gegründet. Der Erzbischof von München-Freising brandmarkte die
Philosophie des Monismus in einem Hirtenbrief. Dennoch hatte der
Monistenbund weiter regen Zulauf: 1912 waren bereits 7000 Mitglieder
beigetreten.
Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam die Arbeit im Monistenbund immer
mehr zum Erliegen. Ab 1933 war der Monistenbund verboten. 1945 wurde er
wieder begründet und unter dem Namen "Freigeistige Aktion- Deutscher
Monistenbund" bis heute mit dem Sitz in Hannover weitergeführt. Er hat
aber lange nicht mehr die Bedeutung wie zu Haeckels Zeiten.
Der Künstler Haeckel
Ernst Haeckels Suche nach dem idealen Symmetriegesetz
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die Persönlichkeit Ernst Haeckels ist dadurch gekennzeichnet,
dass er eigentlich nie den Künstler vom Gelehrten zu trennen vermochte.
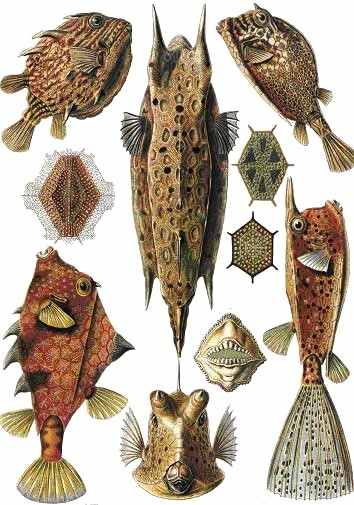
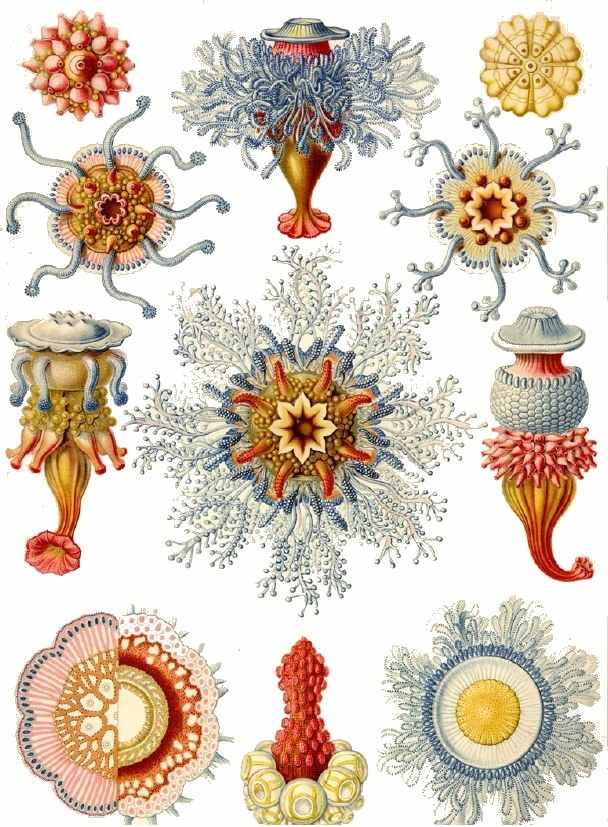
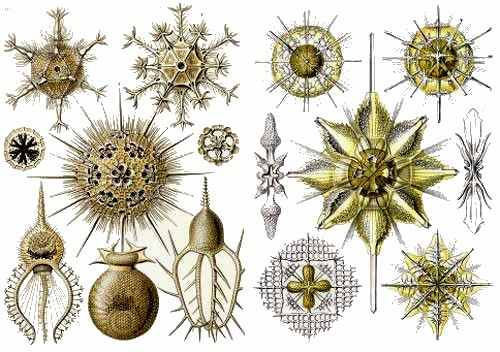
Fische - Staatsquallen Kieselskelette
Es ist daher kein Zufall, dass Haeckel seine
wissenschaftliche Laufbahn als Zoologe mit dem Studium der einzelligen
Radiolarien begann, deren unerschöpfliche Formenvielfalt und deren
außergewöhnliche Schönheit und fast perfekte Symmetrie der
Kieselskelette ihn faszinierten. Jede neuentdeckte Art war für ihn ein
Glücksfang, der ihn "halb unsinnig vor Freude machte". Durch die
intensive Beschäftigung mit den Skelettformen der Radiolarien versuchte
er Gesetzmäßigkeiten für die Gestaltbildung der anorganischen Materie
und der Individuen zu finden. Dabei versuchte er eine organische
Grundformenlehre zu gründen, deren Aufgabe es ist, "die Bestimmung der
idealen Grundform durch Abstraktion aus der realen organischen Form, und
die Erkenntnis der bestimmten Naturgesetze, nach denen die organische
Materie die äußere Gesamtform der organischen Individuen bildet."
Haeckel reduzierte die von ihm betrachteten Organismen auf die ihn
interessierenden Symmetriegrundmuster, und nicht nur bei den
Radiolarien. Bei der Tafel, die Fische zeigen, wird dies besonders
deutlich:
Die Nachricht ist eindeutig: Die Lebensform Fisch wird reduziert auf die
in dieser Tafel einsichtigen Symmetriebezüge. Bei der Suche nach dem
idealen Symmetriegesetz, das durch mathematische Formeln zu beschreiben
ist, das Zurückführen auf Grundformen, zeigt sich die Nähe zu Goethe:
"Nach ewigen, ehernen, großen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins
Kreise vollenden." Haeckel unterschied in seinem System zwei große
Hauptgruppen: Axenlose (unregelmäßig gebaute) und Axenfeste (symmetrisch
gebaute Formen). Als Ursache für die Formgestaltung sah er zwei
formbildende Kräfte an: einen inneren Bildungstrieb (vis plastica
interna), gleichbedeutend mit Erblichkeit und einen äußeren
Bildungstrieb (vis plastica externa), gleichbedeutend mit Variabilität.
Die Wechselwirkung dieser beiden formbildenden Kräfte leitete er
offenbar aus der Goetheschen Metamorphosenlehre ab und setzte den
inneren Bildungstrieb mit dem Urbild, dem Typus, gleich. Prinzipiell
vertrat Haeckel die Ansicht, dass die Ursachen der Formbildung für die
anorganische und organische Form die gleichen seien, die Annahme bewusst
wirkender Zweckursachen somit unnötig sei.
In der Kunst spielt die Symmetrie als ästhetisches Gestaltungsprinzip
eine große Rolle, in der Natur hat die Entstehung von Symmetrien eine
tiefe, evolutionsbiologische Wurzel. So steht z. B. der
bilateral-symmetrische, aber auch der radiär-symmetrische Bau von
Organismen in Zusammenhang mit der Fortbewegung. Aber auch die sexuelle
Selektion begünstigt Symmetrien, man denke nur an die Schönheit von
Gesichtern. Asymmetrien weisen auf Störungen der homöostatischen
Entwicklung hin, symmetrische Individuen besitzen eine höhere
reproduktive Fitness. Doch nicht nur das symmetrische Bauprinzip in der
Natur, sondern auch in der Technik, steht in engem Zusammenhang mit dem
Funktionieren. Wir sprechen von Schönheit der Funktion, nicht von
Schönheit als Funktion.
Der Künstler Haeckel zeigt sich auch in der ästhetischen Betrachtung der Natur.
Ästhetische Naturbetrachtung
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Capri -
Eine ästhetische Naturbetrachtung strebte bereits Alexander
von Humboldt (1769-1859) mit seinen "Ansichten der Natur" an. Die
Anregungen Humboldts und des Botanikers Schleiden, nicht die
Einzelformen, sondern das Ganze eines Naturgemäldes zu erfassen, nahm
Haeckel schon als Gymnasiast auf und diskutierte beispielsweise in einem
Schulaufsatz den "Charakter der norddeutschen Landschaft". In seinen
späteren Skizzen und Aquarellen versuchte er stets die Physiognomik der
Landschaften zu erfassen. Er habe "in jedem Landschaftsbilde einen
Charakter - Ausdruck unseres Planeten - erblickt und seine wesentlichen
Züge in seinen Skizzen wiederzugeben versucht". Haeckel schuf während
seiner über 90 großen Reisen an die 1200 Landschaftsaquarelle,
zahlreiche Skizzen und einige Ölbilder, in denen er stets die Natur in
ihrer Gesamtheit, als ökologische Einheit festzuhalten versuchte. Dabei
betrachtete er sich nicht als vollendeten Künstler: "Ich bin kein
vollendeter Künstler, sondern nur ein enthusiastischer Dilettant.".
Er wollte lediglich mit seinen Bildern die sinnlichen Eindrücke der
Natur einfangen. Naturbetrachtung und Landschaftsmalerei vermitteln
seiner Meinung nach nicht nur Naturgenuss, sondern veredeln und
vervollkommnen auch den Menschen. Entsprechend seiner Vorstellung von
einer Allbeseeltheit der Natur spricht Haeckel von einer Plasmaseele und
er postuliert einen dem Plasma innewohnenden, unbewusst wirkenden
Kunsttrieb.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Das eindrucksvollste Dokument seiner ästhetischen
Naturbetrachtung bildet der 100 Tafeln umfassende Bildband "Kunstformen
der Natur" (1899-1904) mit naturgetreuen Abbildungen überwiegend
wirbelloser mariner Organismen, aber auch mit einigen Darstellungen
höherer Tiere und Pflanzen. Das Buch war das Schmuckstück eines jeden
bürgerlichen Haushaltes. Trotz des populärwissenschaftlichen Charakters
enthält es eine Fülle von Erstbeschreibungen. Eine der schönsten, immer
wieder reproduzierten Formen ist die Meduse Annasethe, eine
südamerikanische Form.
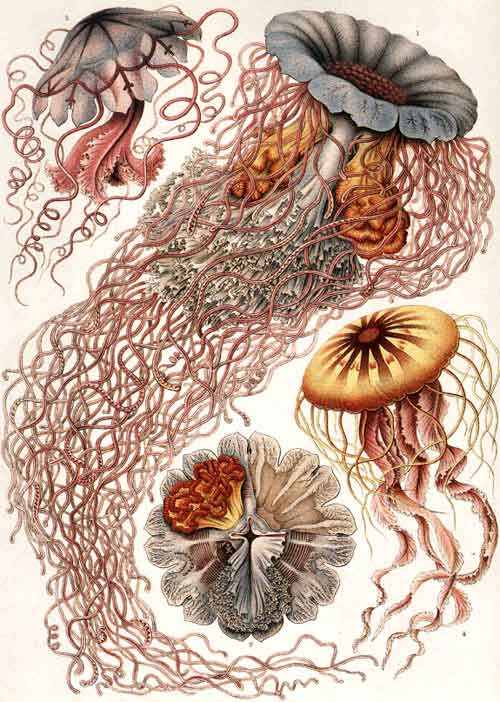
Die Meduse Annasethe Jede Tafel hat zudem eine exemplarische Funktion. Zunächst
erscheinen die bunten Tafeln dem Laien fremdartig. Die netzartigen
Gefüge der Radiolarien wirken vertraut, doch es überrascht, sie in der
Natur zu finden. Haeckel interessieren nicht die existierenden
Lebewesen, sondern die Formeigenschaften, die aber nur dann sichtbar
werden, wenn man die gallertigen, schleimartigen Zellkörper, die ohnehin
bei der Präparation zerstört werden, weglässt und nur die Skelette der
Tiere zeichnet, die die organische Stereometrie (eine Botschaft)
deutlich machen.
In dem Werk werden die Naturformen ganz unvermittelt zu Kunstformen
transformiert, wobei Haeckel ausdrücklich darauf hinweist, dass hier
alle dargestellten Kunstformen in Wahrheit reale Naturformen seien und
von jeder Idealisierung und Stilisierung abgesehen wurde.
Was ist die Ursache für das Schönheitsempfinden? Haeckel als Wegbereiter der Neuroästhetik
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Schon Haeckel suchte nach einer neurobiologischen Erklärung
für das Schönheitsempfinden. So gehört die Wahrnehmung der Schönheit der
Landschaft für ihn " ... durch die physiologischen Funktionen der
Nervenzellen unserer Großhirnrinde, die diese ästhetischen Genüsse
bewirken ... zu den vollkommensten Leistungen des organischen Lebens".
Das Schönheitsempfinden ist also in "ästhetischen Neuronen" oder
"sinnlichen Gehirnzellen" verankert. Aber er wundert sich auch : "Sehr
merkwürdig ist, dass für die Schönheit der Landschaft die absolute
Unregelmäßigkeit , der Mangel von Symmetrie... die erste Voraussetzung
ist." Darauf wusste Haeckel keine Antwort. Schließlich deklariert er
eine aufsteigende Entwicklungsreihe der Schönheit der Naturformen "vom
Einfachen zum Zusammengesetzten", vom Niederen zum Höheren, wobei die
organische Differenziertheit ausschlaggebend ist. Eine Seegurke, ein
unansehnliches Gebilde, erscheint uns primitiver und lange nicht so
schön wie die evolutionär niedriger stehende Staatsqualle (Abb. 22), die
hoch differenziert ist. Das entspricht nach Haeckels Ansicht der
Entwicklung des Schönheitsgefühls des Menschen sowohl ontogenetisch vom
Kind zum Erwachsenen als auch phylogentisch vom "Wilden und Barbaren zum
Kulturkritiker".
Haeckel ist mit seinen Überlegungen zur physiologischen Entstehung von
ästhetischen Empfindungen gewissermaßen ein Wegbereiter der
Neuroästhetik (sie erklärt die ästhetischen Empfindungen auf neuronaler
Basis). Wenn wir als Betrachter die Radiolarien schön finden, hat das
etwas mit der Funktionsweise unseres Wahrnehmungsapparates zu tun.
Unsere Sinnesorgane und unser Zentralnervensystem sind als Ergebnis
einer stammesgeschichtlichen Entwicklung genetisch so programmiert, dass
sie in der Lage sind, Regelmäßigkeiten und damit Ordnung zu erkennen.
Für einen Organismus muss die Welt voraussagbar sein, sonst kann er
nicht in ihr leben. Der Gestaltpsychologe Wolfgang Metzger (1936) sprach
in diesem Zusammenhang von einer "Ordnungsliebe der Sinne". Das ist der
Grund, weshalb wir Kristalle schön finden oder Organismen, seien sie
nun bilateral oder radiärsymmetrisch gebaut.
Ob wir etwas als schön oder hässlich empfinden, beruht unter Anderem
auch auf angeborenen Schemata. Weitere Schemata bilden sich neu über
Lernprozesse individueller und kultureller Erfahrung. Man denke nur an
das von Konrad Lorenz beschriebene Kindchenschema. Da das Gesicht eine
große Bedeutung für die zwischenmenschliche Kommunikation hat, erstaunt
es nicht, dass es bei Affen und Menschen eine eigene Hirnregion gibt,
die dem Gesichtererkennen dient. Ein ästhetisches Vorurteil besonderer
Art stellt die Positivbewertung von Pflanzen dar. Vermutlich spiegelt
sich in ihr eine archaische, ästhetische Prägung wieder. Wo Pflanzen
gedeihen, fanden unsere Vorfahren auch alles, was sie zum Leben
brauchten. In ähnlicher Weise ist uns auch eine archaische ästhetische
Präferenz für einen Landschaftstyp vorgegeben, in dem sich die
Menschwerdung vollzog, nämlich den der Savanne. Die Savannenpräferenz
zeigt sich nach Untersuchungen von E. Synek (1998) hauptsächlich im
vorpubertären Alter. Danach überlagert sich dieser sekundär eine
Vorliebe für den Landschaftstyp, in dem man aufwächst, was man mit
Heimat charakterisiert. Hier handelt es sich um eine prägungsähnliche
Festlegung, deren neuronale Grundlagen mittlerweile bekannt sind.
Wirkungen
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die von Haeckel gezeichneten Radiolarien, Polypen, Quallen,
Korallen und Algen wurden durch den Jenaer Lithographen Adolf Giltsch
meisterhaft umgesetzt und dienten Kunsthandwerkern, Bildhauern,
Zeichnern und Architekten als Vorlage zu ornamentaler Gestaltung.
Bedeutende Künstler des Jugendstils, der zu dieser Zeit bereits nicht
mehr vom floralen, sondern vom abstrakten Stil Henry van de Veldes
(1863-1957) geprägt war, bedienten sich dieser neuen Formenwelt, um der
Kunst neue Impulse zu verleihen. Die industrielle Revolution brachte es
mit sich, dass die maschinelle Herstellung von Möbeln, Teppichen,
Tapeten und Stoffen zu einer tausendfachen Vervielfältigung der Muster
führte, so dass die herkömmlichen Motive bald erschöpft waren. So
eröffneten auch hier die Haeckel'schen Zeichnungen der marinen Organismen
eine völlig neue Perspektive.
Welchen Einfluss hatte Haeckel nun auf den deutschen Jugendstil?
Der Kunsthandwerker, Bildhauer und Architekt Hermann Obrist (1863-1927)
hatte naturwissenschaftliche und medizinische Studien absolviert und
betätigte sich später als Künstler, der die Haeckelschen Formen für
Skizzen, Zeichnungen, Vasen und Brunnenmodelle benutzte. Der Pariser
Architekt René Binet (1806- 1911) nahm eine Radiolarie als Vorbild für
das Monumentaltor zur Pariser Weltausstellung 1900:
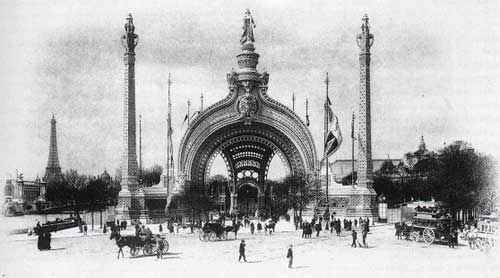
Ernst Haeckel selbst ließ sein im italienischen Landhausstil
erbautes Wohnhaus mit Medusenornamenten als Deckengemälde schmücken, von
denen drei noch erhalten geblieben sind.
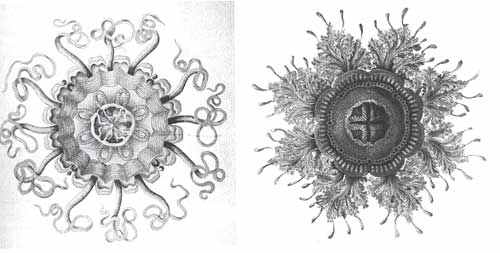

Auch die Fassade des von ihm 1907 in Jena begründeten
Phyletischen Museums wurde auf seinen Wunsch hin mit Stuckornamenten
stilisierter mariner Tierformen verziert.
Große Freude machte es ihm, als er zur Eröffnung des Oceanographischen
Museums in Monaco 1910 im Vestibül einen Kronleuchter bewundern konnte,
der einer von ihm dargestellten Meduse nachgestaltet wurde.
Auch wenn Haeckels ästhetische Theorie heute längst Geschichte ist, sind
seine Darstellungen der Radiolarien noch immer Gegenstand der
Diskussion. So nimmt die moderne Architektur darauf Bezug, weil gerade
in der Skelettform der Radiolarien größte Stabilität mit geringsten
Mitteln erreicht wird und die Natur hier effiziente Vorbilder für
architektonische Gestaltung liefert.
Kritik
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Einige kritische Anmerkungen möchte ich zu Haeckel als Naturwissenschaftler anfügen.
Dabei möchte ich drei Punkte näher betrachten.
1. Bei der Anwendung des Auslesegedankens führte Haeckels
Unvorsichtigkeit zu bedenklichen Reaktionen. Im Gegensatz zu Darwin, der
einmal in Bezug auf die Entwicklungsstufen schrieb: "Sage nie höher
oder niedriger", glaubte Haeckel die Selektionstheorie auf die
menschliche Gesellschaft übertragen zu können. In diesem Punkt kann er
als Wegbereiter der späteren Sozialdarwinisten angesehen werden, die
erfolgreiche und skrupellose Menschen als angepasst bezeichneten und die
die partielle Abschwächung des Daseinskampfes durch Sozialpolitik,
Bevölkerungskontrolle oder medizinische Versorgung als Verhängnis
ansahen. Dies war sicher jedoch nicht im Sinne Haeckels. Stets wandte er
sich gegen einen "sittlichen Materialismus", im Sinne von Gier nach
materiellen Gütern.
2. Das Biogenetische Grundgesetz, genial und vereinfachend formuliert,
hatte scharfe Reaktionen zur Folge, vor allem, weil sein Umgang mit
Druckstöcken, die die frühesten Embryonalstadien zeigten, etwas zu
großzügig war. So hatte er für drei von ihnen - Hund, Huhn und
Schildkröte- einfach dasselbe Klischee verwendet, da sie in dieser Phase
ohnehin nicht unterscheidbar wären.
3. Weder Darwin noch Haeckel sahen in der natürlichen Zuchtwahl einen
Gegensatz zu Lamarcks "Vererbung erworbener Eigenschaften" beim
Zustandekommen von Anpassungen in der Evolution. Darwin spekulierte
später über Mechanismen eines Informationsrückflusses von den
Körperzellen auf die Keimbahn in seiner "Pangenesis-Theorie", die aber
unbeachtet blieb. Haeckel erklärte Phänomene wie die dunkle Haut der
Schwarzafrikaner mit der ökologischen Gewohnheit, die - sofern lang
genug wirkend - zum erblichen Merkmal einer Art geworden sei. Auch die
Asymmetrien, z. B. der Gehäuseschnecken oder der adulten Schollen,
Ausnahmen im Formenkanon des Lebens, sind für Haeckel die schönsten
Beispiele für die Vererbung erworbener Eigenschaften.
Beruhen also manche von Haeckels Hypothesen und Theorien teilweise auf
falschen Grundannahmen, hatten sie jedoch einen großen heuristischen
Wert und gaben der weiterführenden Forschung wertvolle Impulse.
Würdigung und Weiterführung
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
So schreibt Ernst Mayr, einer der bedeutendsten
Evolutionsbiologen der Gegenwart: "Die Evolution ist keine Theorie,
sondern eine tausendfach belegte Tatsache". Über die Ursachen des
Ablaufs kam es in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts zu einem
Zusammenschluss der wichtigsten biologischen Disziplinen und Positionen,
die zur so genannten "Synthetischen Theorie" der Evolution führten. Sie
basiert auf den Überlegungen Darwins und kann durch das Zusammenwirken
von "Genetischer Variabilität" und "Selektion" beschrieben werden. Die
genetische Variabilität einer Population wird nicht nur von der
Rekombination der elterlichen Erbanlagen und 'zufälligen' Mutationen
bestimmt. Es konnte gezeigt werden (EIGEN 1988), dass Mutanten
keineswegs völlig regellos entstehen, sondern vor allem aus recht häufig
erscheinenden Vorläufern. Es scheint, als ob bereits der gesamte
Mutantenclan von der Selektion bewertet würde. Zudem lieferten uns erst
kürzlich Molekulargenetiker den Beleg von sogenannten 'springenden
Genen', die die genetische Variabilität weiter steigern. Die natürliche
Auslese, die Darwin und Haeckel beschrieben, ist das Ergebnis, nicht der
Vorgang. Heute kann Evolution künstlich im Reagenzglas nachvollzogen
werden! Es lassen sich beispielsweise verschiedene mutierte Formen von
Nucleinsäuren ('Erbmoleküle') erzeugen, auf die man dann einen
Selektionsdruck ausübt. Es reichern sich dann solche Moleküle an, die
dem Milieu besser angepasst sind. Auf diese Weise kann man innerhalb
weniger Tage Nucleinsäuren "züchten, die von einem Verdauungsenzym nicht
angegriffen werden. Die Selektion ist also nicht nur "stabilisierend"
tätig, indem sie Negatives "ausmerzt", sondern sie kann auch konstruktiv
wirksam sein. Komplexität, Schönheit und Leistungsfähigkeit eines
Bauplans sind ebenfalls ihr Ergebnis.
Es ist vor allem das Versagen aller 'Gegentheorien', was die universelle
Annahme der synthetischen Evolutionstheorie gefördert hat.
Auch die moderne Soziobiologie überträgt die Evolutionstheorie auf das menschliche Sozialverhalten.
Ausblick
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Der englische Biologe DAWKINS (1978) bezeichnet in seinem
Buch 'Das egoistische Gen' das Individuum als "eine eigennützige
Maschine, die so programmiert ist, dass sie das tut, was immer für ihre
Gene als Gesamtheit am besten ist". Dawkins zeigt, dass in unserem
Verhalten Antriebe fortwirken, die die Freiheit des menschlichen
Verhaltens erheblich einschränken. Die Fortschritte in der
Molekularbiologie, die zunehmenden Erkenntnisse in den
Naturwissenschaften schaffen Ernüchterung, viele Menschen geraten in
einem Glaubenskonflikt oder fühlen sich zumindest gedemütigt. Der Mensch
ist Teil der Natur, die Naturgesetze sind Teil der Schöpfung. Es gilt,
diese Gesetze zu erforschen, nur so sind wir aktiv am Vollzug der
Schöpfung beteiligt, einer Schöpfung, die noch im Entstehen ist, die
noch nicht abgeschlossen wurde. Die von uns erlebte Wirklichkeit ist nur
Teil einer viel größeren Wirklichkeit, die schrittweise aus ihrer
Verborgenheit hervorkommt. Auch wenn wir Menschen den Naturgesetzen
unterliegen, so sind wir doch als einzige in der Lage, sie zu ergründen
und Verantwortung für den Ablauf der Dinge zu übernehmen. Die
biologische Erkenntnistheorie ist nicht dahingehend zu interpretieren,
als ob die Biologie den gesamten "Erkenntnis-Apparat" bestimmt, der
Mensch also unfrei sein müsste. Und auch DAWKINS schließt sein Buch
versöhnend: " Wir sind als Genmaschinen gebaut und werden als
Memmaschinen (analog zum Gen die Einheit der kulturellen Vererbung)
erzogen, aber wir haben die Macht, uns unseren Schöpfern
entgegenzustellen. Wir allein, einzig und allein wir auf der Erde,
können uns gegen die Tyrannei der egoistischen Replikatoren auflehnen"
(DAWKINS 1978, S. 237).
Lebensabend und Bilanz
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
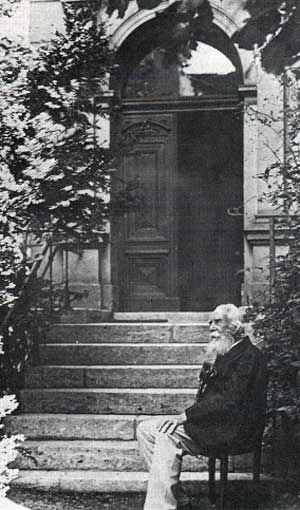
Ernst Haeckel vor seiner Villa Medusa
Wie sieht nun die Bilanz von Haeckels Lebens aus?
1907 erfolgte die offizielle Gründung des Phyletischen Museums, das
Haeckel schon 1879 geplant hatte. Im selben Jahr schied er 75-jährig
offiziell aus dem Lehramt aus.
1915 starb seine Frau Agnes, die in den letzten Lebensjahren wieder
größere Bedeutung für Haeckel gewonnen hatte, so dass er nach ihrem Tod
sehr vereinsamte, zumal seine Kinder nicht in der Nähe wohnten.
1918 erklärte sein Sohn Walter, Kunstmaler in Sonthofen, den Verzicht
auf das elterliche Wohnhaus, die Villa Medusa, die Haeckels Wunsch gemäß
nach seinem Tod als Museum eingerichtet werden sollte.
In den letzten Lebensjahren nahmen seine Körperkräfte immer mehr ab; er
lebte zurückgezogen in seiner Villa, war unablässig mit dem Ordnen
seiner umfangreichen wissenschaftlichen und künstlerischen Sammlung
beschäftigt. Bis zuletzt malte er vom Balkon seines Hauses aus. Am 9.
August 1919 starb Haeckel.
In der Rückschau müssen wir Ernst Haeckel als einen der bekanntesten und
beeindruckendsten, zugleich aber auch umstrittensten
Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts betrachten, der wie kein
anderer Biologe seiner Zeit über sein Fachgebiet hinaus das Geistesleben
seiner Zeit mitbestimmt hat.
Im August 1999
Dr. Angelika Weiß-Merklein
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Literatur:
Krauße, Erika "Ernst Haeckel", Leipzig 1984
Museum Ernst-Haeckel-Haus der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Dawkins, Richard "Das egoistische Gen", Berlin, Heidelberg, New York 1978
Haeckel, Ernst "Kunstformen der Natur", New York 1998
Ausstellungskatalog "Hackel e l'Italia - La vita come scienza e come storia", Padova und Jena 1993
Ausstellungskatalog "Welträtsel und Lebenswunder - Ernst Haeckel - Werk,
Wirkung und Folgen", Oberöstereichisches Landesmuseum 1998
|
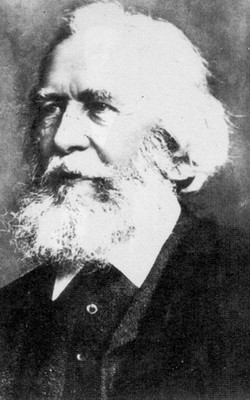
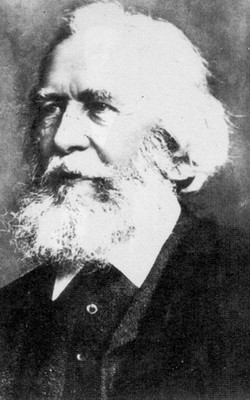
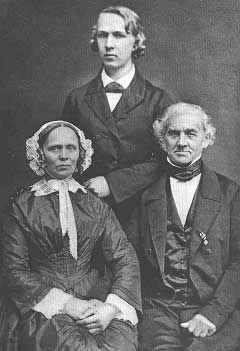
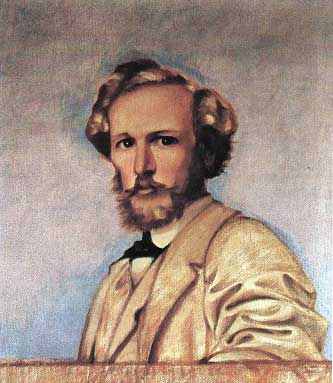


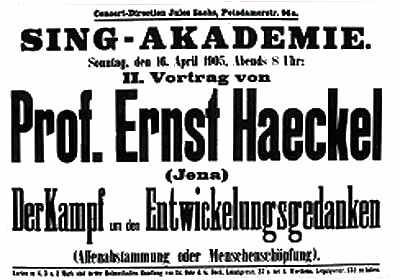
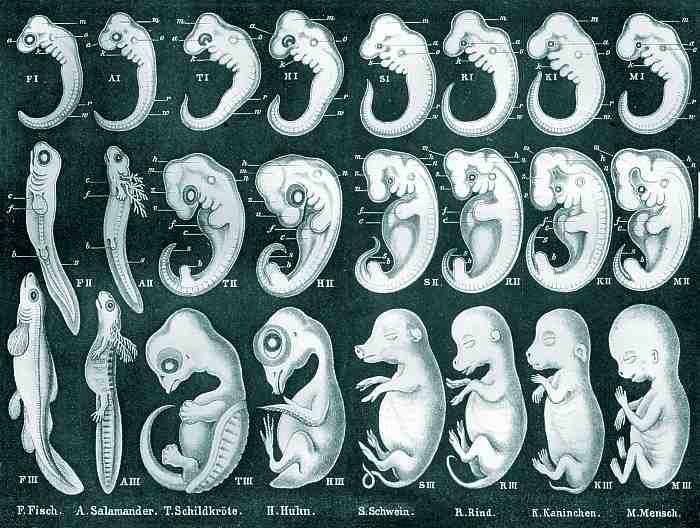
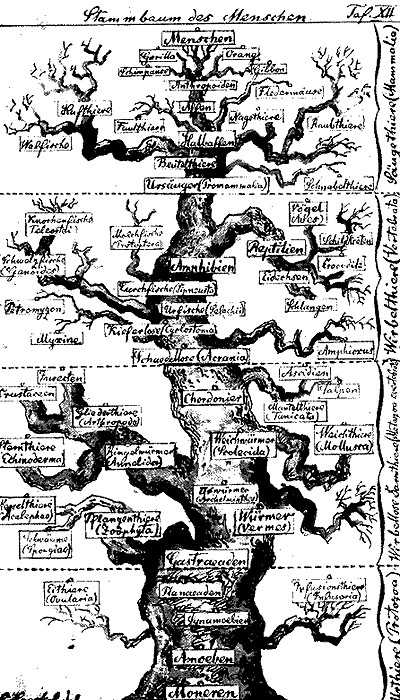
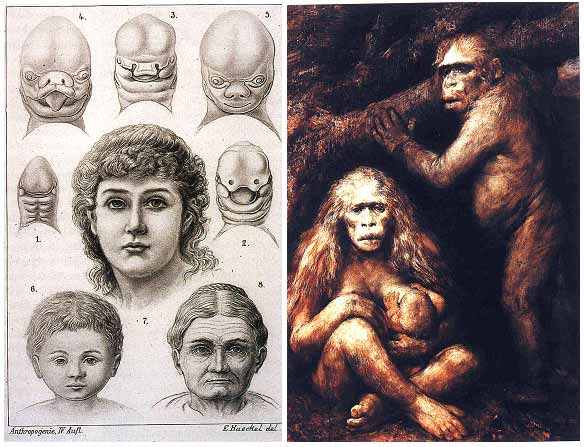
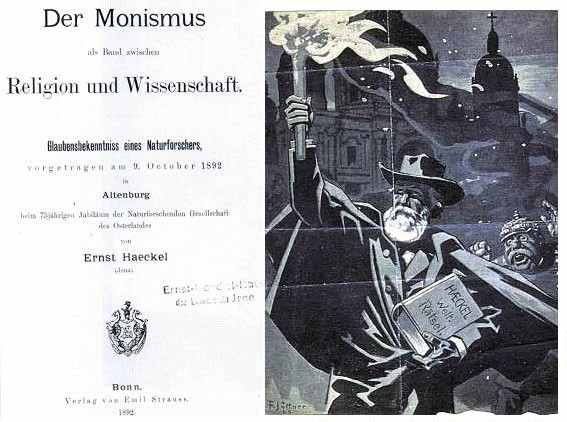
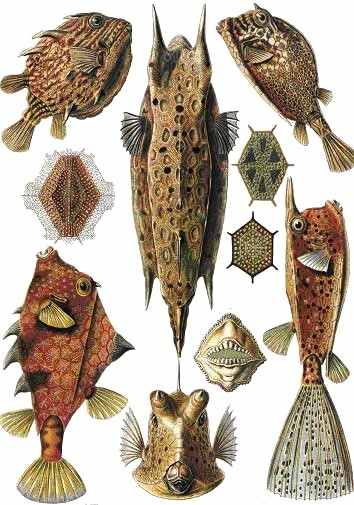
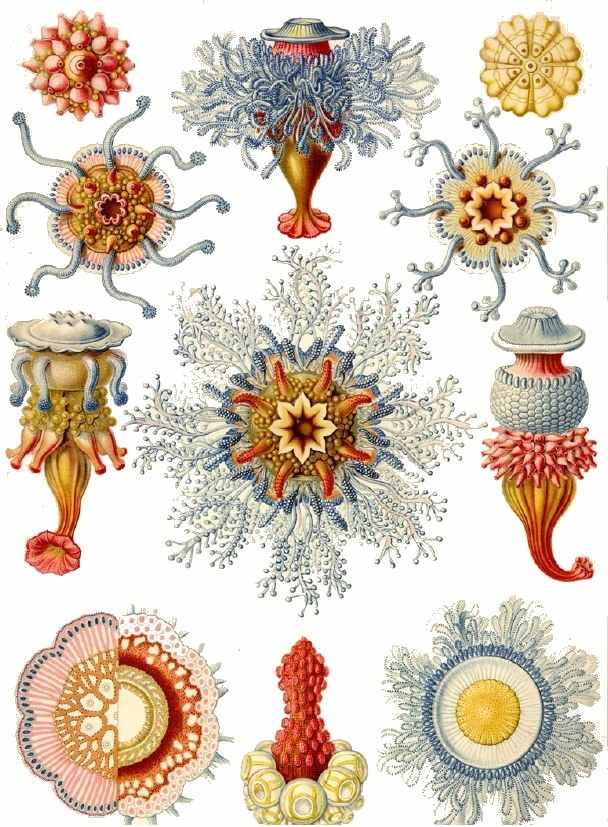
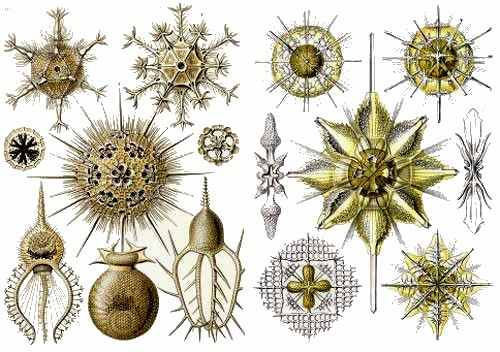

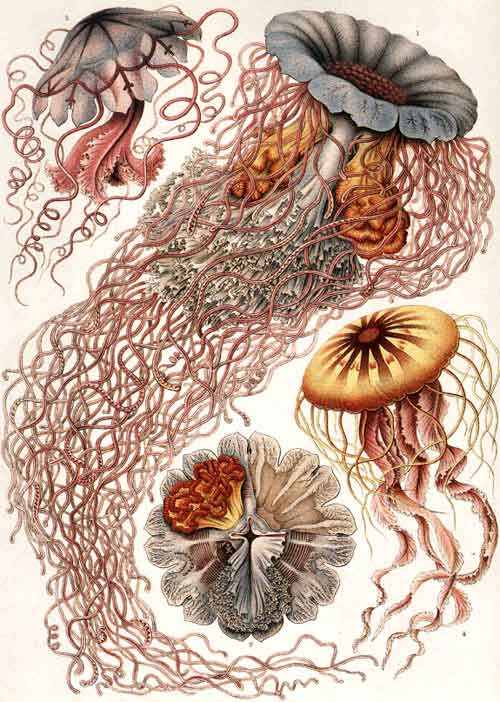 Die Meduse Annasethe
Die Meduse Annasethe